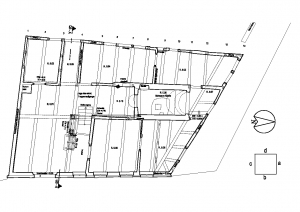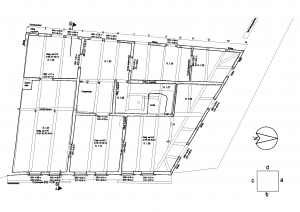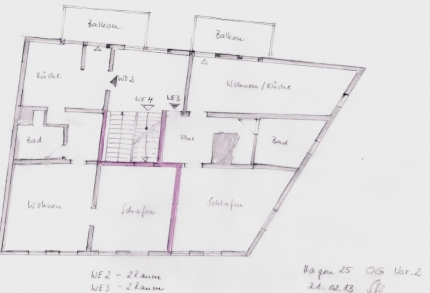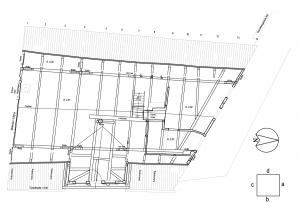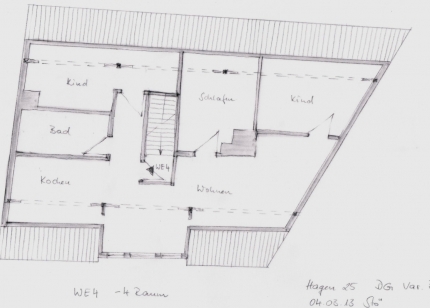Schadensaufnahme und Sanierungsempfehlungen
Bevor Anfang 2013 mit dem Eigentümerwechsel Sicherungs- und Rückbaumaßnahmen am Objekt Hagen 25 erfolgten, stand es mehrere Jahre leer. Die zu diesem Zeitpunkt vorgefundenen Schäden und Mängel an der Substanz beruhen vorwiegend auf Schäden in der Dachdeckung und –entwässerung, den jahrelangen Leerstand und die damit fehlende Wartung und Instandhaltung. Durch den ungehinderten Zutritt von Feuchtigkeit, Ungeziefer, aber auch illegale Müllablagerungen entstanden gravierende Schäden insbesondere am Dachwerk, an Deckenbalken und Deckenfüllungen sowie an den Fachwerkhölzern und angrenzenden Gefachfüllungen der hofseitigen Westfassade sowie am freistehenden Nordgiebel. Der Sandsteinsockel des Nordgiebels erhebt sich zudem aus dem Lauf des Mühlgrabens und ist somit einer stetigen Wasserberührung ausgesetzt. Sowohl der im Bachbereich liegende Sandsteinsockel als auch die aufgehende Fachwerkwand im Erdgeschoss neigten sich bereits nach außen (1).
Durch den hinzugezogenen Holzschutzsachverständigen ist im Bereich Obergeschoss/Dachgeschoss an der westlichen Seite des Nordgiebel
ein Befall mit Echtem Hausschwamm nachgewiesen worden, welcher sich durch die typischen ausgeprägten Myzelstränge und den groben
Würfelbruch an den Konstruktionshölzern darstellt (2).
Durch die bereits ohne fachplanerische Begleitung begonnenen Rückbauarbeiten kam für die Schadbereiche des Echten Hausschwamms nur
noch eine konventionelle Sanierung mit Rückschnitt der befallenen Hölzer und Rückbau der angrenzenden Gefach in Betracht (3).

Abb. 2 Befall durch den Echten Hausschwamm im westlichen Obergeschoss des Nordgiebels (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)

Abb. 3 Befall durch den Echten Hausschwamm im westlichen Obergeschoss des Nordgiebels (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)
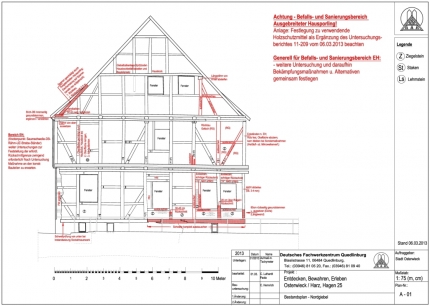
Abb. 4 Kartierung der Schäden und Maßnahmen am Nordgiebel (DFWZ in Zusammenarbeit mit R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)
Aufgrund der starken Schädigungen der konstruktiven Hölzer durch die benannten tierischen Schädlinge und Pilze und der damit
verbundenen statisch-konstruktiven Beeinträchtigungen des Nordgiebels, weiterer Schäden an der Westfassade und den einbindenden
Innenwänden, der nicht fachplanerisch begleiteten und somit leichtfertig ausgeführten Rückbauarbeiten sowie unzureichender
Absteifungen bestand zum Zeitpunkt der Schadensaufnahme durch den Sachverständigen Einsturzgefahr. Eine sofortige Konsultation
eines Tragwerkplaners war zwingend erforderlich (8).
Unabhängig von den Untersuchungsergebnissen des Holzschutzgutachters waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Holz-Geschosstreppen,
die Dacheindeckung, etliche Deckenbalken und Deckenfüllungen, bestehend aus Lehmwickeln und Dielen in den westlichen Räumen sowie
zwei in die westliche Außenwand einbindende Fachwerkinnenwände zurückgebaut.
Die Räume im Obergeschoss an der Westfassade waren nicht begehbar, da die Deckenfüllungen fehlten und keine Sicherungslage
eingebaut war. Durch den Rückbau der Deckenfelder und das unkontrollierte Abtrennen von Deckenbalken wurde nicht nur das
Fachwerkgefüge als (normalerweise) in sich geschlossenes statisches Gesamtgefüge geschwächt, im Erdgeschoss waren dadurch Innenwände,
z.B. im Bereich des Durchgangs zur Hofseite abgängig. Diese Wand musste beidseitig abgestützt werden, weil sie ansonsten komplett
umgestürzt wäre. Am Nordgiebel war zudem ein Teil des Fußbodens zum Keller eingebrochen.
An erster Stelle der Sanierungsmaßnamen sollte demnach unter Einbeziehung des Tragwerksplaners und des Holzschutzsachverständigen
die fachgerechte Ertüchtigung der Fachwerkkonstruktion, Ergänzung der fehlenden und geschädigten Deckenbalken und der schadhaften
Dachkonstruktionshölzer in traditioneller Zimmermannstechnik stehen. Hierzu gehört auch ein entsprechender Schutz des Gebäudes vor
Niederschlagswasser, z.B. der Schutz der Dachfläche durch Folien bzw. nachfolgend eine entsprechende Dacheindeckung. Weiterhin
gehört die fachgerechte Sanierung des Sockelmauerwerkes, beginnend am im Bachlauf stehenden Nordgiebel und weiterführend an der
Westfassade zu den vorrangigen Ertüchtigungsmaßnahmen.

Abb. 9 KG/EG – eingebrochener Kellerfußboden im Bereich Westfassade/ Nordgiebel (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)
Bei größeren Fehlstellen oder Unebenheiten auf der Innenseite der Außenwand muss eine Ausgleichsschicht aufgetragen werden. Der
Ausgleich sollte sich in Struktur und Beschaffenheit dem Bestand anpassen und vor der Weiterverarbeitung ausgetrocknet sein.
Nachdem die zu dämmenden Flächen und die Plattenränder mit CELLCO® Contact-Dämm-Mörtel eingestrichen und die Dämmplatten in die
feuchte Kontaktmasse homogen angedrückt wurden, sind zusätzliche Befestigungspunkte durch Tellerdübel (ca. 5 - 6 Stk/qm) zu fixieren
und der zweilagige Lehmputz auf einem Putzträger, beispielsweise Schilfrohrmatten, aufzutragen (10).
Holzfaserdämmplatten bestehend aus Holzweichfasern sind je nach Hersteller in unterschiedlichen Ausführungen im Handel erhältlich.
So sind z.B. Pavadentro-Platten, die bereits mit einer innenliegenden mineralischen Funktionsschicht für einen kontrollierten
Feuchtetransport ausgestattet sind (11) oder dreischichtige Holzfaserdämmplatten mit unterschiedlicher Dichte der jeweiligen Lage, die
mit PVAC-Weißleim miteinander verklebt sind, aber eine zusätzliche dampfdiffusionsstabilisierende Schicht mit Gewebeeinlage – einen
sogenannten Multigrund erfordern, auf dem Markt erhältlich.
Die Holzfaserdämmplatten werden vollflächig mit Lehmmörtel oder dem herstellerspezifischen Kontaktdämmmörtel eingeschwemmt. Die
Befestigung erfolgt ausschließlich im Dübelverfahren, wobei 5 - 6 Tellerdübel je qm vorzusehen sind. Beim Aufkleben der Dämmplatten
sind Kreuzfugen zu vermeiden. Der zuvor evtl. aufgebrachte Ausgleichsputz darf noch feucht, aber nicht nass sein. Auch bei den
Holzfaserdämmplatten erfolgt raumabschließend das Auftragen eines zweilagigen Lehmputzes mit Gewebeeinlage
(12).